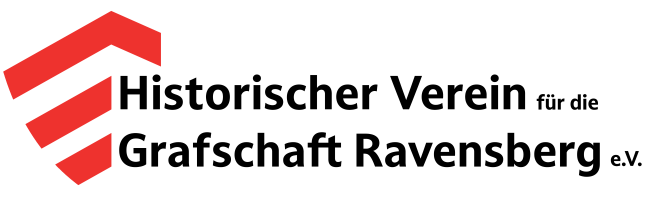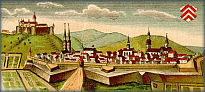Neuerscheinungen
Ravensberger Blätter, Ausgabe 2025
Zwangssterilisation und NS-Euthanasie" in der Region

Editorial
Kerstin Stockhecke / Rolf Westheider
-
Beiträge
Einleitung
Hans-Walter Schmuhl
S. 4 - 7Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“
Mechthild Stockmeier
S. 8 - 15Das Bielefelder Erbgesundheitsgericht
Ulrich Wehmann
S. 16 - 21Zwangssterilisierung im Amt Versmold 1934-1943. Eine Zwischenbilanz
Johannes Geldermann und Rolf Westheider
S. 22 - 27Angezeigt in Bielefeld wegen Epilepsie!
Zwangssterilisation im Nationalsozialismus
Margarete Pfäfflin
S. 28 - 35„Angeboren schwachsinnig“ und „typisch jüdisch“. Fallstudie über die Zerstörung eines Lebens durch Ausgrenzung, Zwangssterilisation und Vernichtung
Arbeitskreis „Spuren jüdischen Lebens in Werther“.
Projektgruppe Fallstudie Max Sachs
S. 36 - 45„Darüber hinaus sei der Unfruchtbargemachte in Anspruch zu nehmen“.
In Patientenakten dokumentierte Reaktionen von Männern der psychiatrischen Klinik Morija in Bethel 1934 - 1945 auf ihre Zwangssterilisation
Christian Zechert
S. 46 - 53Das katholische Amt Verl im Landkreis Wiedenbrück und die nationalsozialistischen Zwangssterilisationen. Eine erste Bestandsaufnahme von Quellen und Literatur
Annette Huss
S. 54 - 61„Landläufige Dummheit“? Der Haller Kreismedizinalrat Dr. Gustav Diering und seine Beteiligung an Zwangssterilisierungsverfahren am Beispiel der jungen Rosa Diekmann
Katja Kosubek
S. 62 - 69„...wenn die Erbkranke dennoch so asozial bleibt, würde ich Euthanasie vorschlagen“
Die Karriere des Kriegsverbrechers Dr. Hans Otto Brunner am Bielefelder Gesundheitsamt
Annette Meyer zu Bargholz
S. 70 - 77Wilhelm Blanke - Ein psychisch erkrankter Lehrer aus Versmold im Räderwerk der „Aktion T4“. Einblicke in die vielfältigen Wege der Recherche
Johannes Geldermann
S. 78 - 85„Ruth ist abgeholt worden“. Der Tod einer 15-jährigen aus Borgholzhausen in der Provinzial-Heilanstalt Marsberg
Eva-Maria Eggert
S. 86 - 95 -
Vereinsnachrichten
Exkursion zum LWL-Museum Zeche Zollern:
„Das ist kolonial. Westfalens (un)sichtbares Erbe“ (14. September 2024)
Barbara Frey / Bärbel Sunderbrink
S. 96 - 97Zwischen Wandel und Beharrung. Das 3. Ravensberger Kolloquium blickte auf das 18. Jahrhundert (25. Januar 2025)
Michael Zozmann
S. 98Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins (15. März 2025)
Barbara Frey
S. 99 -
Buchanzeigen
Ulrich Rottschäfer, „Mein Gefängnis ist mein Paradies“. Die letzte öffentliche Hinrichtung in Westfalen als Demonstration eines „erweckten“ Glaubens (Ulrich Andermann)
S. 100Jochen-Christoph Kaiser und Uwe Kaminsky (Hg.), Biologiepolitik und Evangelische Kirche. Die Protokolle des „Ständigen Ausschusses für Rassenhygiene und Rassenpflege“ der Inneren Mission 1931 - 1938 (Karsten Wilke)
S. 101Neuerwerbungen der Landesgeschichtlichen Bibliothek Bielefeld
S. 102 - 103 -
Veranstaltungshinweis
Verleihung des Ravensberger Geschichtspreises (22. November 2025) (Ulrich Andermann)
Ausblick auf die Ravensberger Blätter 2026
Impressum/Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Heftes sowie Mitglieder der Projektgruppe
S. 104
ISSN 1866-041X, Preis 9,50 €
29. Sonderveröffentlichung
Clamor Huchzermeyer (1809-1899)
Ein Landpfarrer, Politiker und Superintendent
im Rahmen der Minden-Ravensberger Erweckungsbewegung
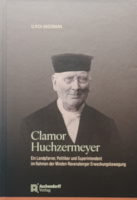
Autor: Ulrich Andermann
Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster. 2025, 28,00 €
ISBN 978-3-402-25202-4 (Print), ISBN 978-3-402-25203-1 (ePDF)
- Vorwort
S. 9 - I. Einleitung
S. 11 – 14 - II. Biographische Anfänge
S. 15
- 1. Herkunft
S. 15 - 16 - 2. Schule, Studium und die Zeit als Pfarramtskandidat
S. 16 - 19 - 3. Die Anstellung als Hilfsprediger
S. 20 - 22 - 4. Heirat und Familiengründung
S. 22 - 24
- 1. Herkunft
- III. Die Zeit als Hilfsprediger seit 1840
S. 25
- 1. Theologische Strömungen
S. 25 - 26
- a. Der Pietismus in Minden-Ravensberg
S. 26 - 27 - b. Die „Lichtfreunde“ als Vertreter der rationalistischen Theologie
S. 27 - 28 - c. Das Problem mit dem Gesangbuch
S. 28 - 31
- a. Der Pietismus in Minden-Ravensberg
- 2. Kampf gegen gesellschaftliche und wirtschaftliche Missstände
S. 32
- a. „Branntweinpest“ und Mäßigkeitsbewegung
S. 32 - 38 - b. Gewerbepolitisches Engagement:
Rettungsversuche für die Schildescher Spinner und Weber
S. 38 - 40
- a. „Branntweinpest“ und Mäßigkeitsbewegung
- 3. Huchzermeyer als christlich-konservativer Parlamentarier in der Preußischen
Nationalversammlung im Jahr 1848/49
S. 41- 42
- a. Das Umfeld: der Konservatismus im Wahlkreis Bielefeld
S. 42 - 44 - b. Spuren der Parlamentarierzeit
S. 44 - 47 - c. Märzrevolution und demokratischer Aufbruch im Urteil Huchzermeyers
S. 47 - 49 - d. Die politische Grundhaltung – eine vorläufige Zusammenfassung
S. 49
- a. Das Umfeld: der Konservatismus im Wahlkreis Bielefeld
- 4. Erweckungsbewegung und Innere wie Äußere Mission in Minden-Ravensberg
S. 49 - 50
- a. Ursprünge, Traditionen, Ausdrucksformen und Protagonisten
- aa. Die Erweckung als vorherrschende Form protestantischer Religiosität
S. 50 - 53 - bb. Diakonische Arbeit und Innere Mission
S. 53 - 54
- aa. Die Erweckung als vorherrschende Form protestantischer Religiosität
- b. Tätigkeitsfelder und Initiativen des Hilfspredigers Huchzermeyers
- aa. Agent für die Verbreitung von Erbauungsliteratur
S. 54 - 57 - bb. Missionsfeste und Äußere Mission
S. 57 - 60 - cc. Frühe Gründungsinitiativen im Sinne der Inneren Mission
S. 60 - 62
- aa. Agent für die Verbreitung von Erbauungsliteratur
- a. Ursprünge, Traditionen, Ausdrucksformen und Protagonisten
- 1. Theologische Strömungen
- IV. Die Zeit als Gemeindepfarrer seit 1850
S. 63- 1. Strukturen: die preußische Kirchenprovinz Westfalen im 19. Jahrhundert
S. 64- a. Von der Säkularisation des Stiftes Schildesche 1810 bis zur Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835
S. 64 - 68 - b. Entwicklung der Diöcese Bielefeld
S. 68 - 70 - c. Entwicklung der Schildescher Patronatsgemeinde
S. 70 - 75
- a. Von der Säkularisation des Stiftes Schildesche 1810 bis zur Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835
- 2. Huchzermeyers Spuren – vornehmlich in der Kirchengemeinde Schildesche
S. 75 - 76- a. Historiographische Hinterlassenschaften
S. 76 - 78 - b. Das Rettungshaus und die Präparandenanstalt auf der Schildescher Heide
S. 78 - 88 - c. Das Evangelisch-Stiftische Gymnasium zu Gütersloh
S. 88 - 93 - d. Ringen um den Fortbestand der gemeindlichen Armenfürsorge
S. 93 - 97 - e. Wiederaufbau des Schildescher Kirchturms
S. 97 - 100 - f. Das Pflege- und Krankenhaus, genannt „Huchzermeier-Stift“
S. 100 - 106 - g. Der Schildescher Jünglingsverein sowie Posaunen- und Kirchenchor
S. 107 - 110 - h. Anfänge der Epilepsiearbeit in Bethel und Huchzermeyers Verhältnis zu Friedrich von Bodelschwingh
S. 110 - 112
- a. Historiographische Hinterlassenschaften
- 1. Strukturen: die preußische Kirchenprovinz Westfalen im 19. Jahrhundert
- V. Die Superintendentur (1872-1894): ein Amt in hohem Alter
S. 113- 1. Weitere Institutionalisierung der Inneren Mission
S. 114 - 117 - 2. Nichtsesshaftenhilfe in der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf
S. 117 - 120 - 3. Ein altes Thema: die Enthaltsamkeitssache
S. 120 - 122 - 4. Die „Commission zur Hebung der Parochialnoth“
S. 122 - 124 - 5. Herausforderungen in Zeiten des Kulturkampfes
S. 124 - 125
- a. Schulaufsichtsgesetz und der Kampf gegen die Simultanschulen
S. 125 - 127 - b. Zivilstandsgesetzgebung
S. 127 - 128 - c. Das Problem der „Dissidenten“
S. 128 - 130
- a. Schulaufsichtsgesetz und der Kampf gegen die Simultanschulen
- 6. Herausforderungen durch die Sozialdemokraten
S. 130 - 132 - 7. Huchzermeyer auf der Berliner Generalsynode 1879
S. 132 - 134 - 8. Das Verhältnis zu Adolf Stoecker, Karl Iskraut und die Einstellung zum Judentum
S. 134 - 142
- 1. Weitere Institutionalisierung der Inneren Mission
- VI. Huchzermeyers später Ruhestand (1894-1899)
S. 143
- 1. Schwieriger Abschied von Schildesche und die Emeritierung nach Gütersloh
S. 144 - 147 - 2. Lange Amtszeit, die Frage der Altersversorgung und der Tod im Jahr 1899
S. 147 - 151 - 3. Würdigungen
S. 151 - 154
- 1. Schwieriger Abschied von Schildesche und die Emeritierung nach Gütersloh
- VII. Zusammenfassung
S. 155 - 162 - Anhang
Abkürzungen
S. 165 - Anmerkungen
S. 167 - 187 - Quellenverzeichnis
- I. Archivalische Quellen
S. 189 - 191 - II. Gedruckte Quellen
S. 192 - 193
- I. Archivalische Quellen
- Literaturverzeichnis
S. 195 - 208 - Personenregister
S. 209 - 212 - Ortsregister
S. 213 - 216
Clamor Huchzermeyer (1809-1899) gehört zu den wirkungsmächtigsten Vertretern der Minden-Ravensberger Erweckungsbewegung. Nicht nur in seiner Heimatgemeinde Schildesche, sondern auch in der „Diöcese“ Bielefeld und in der preußischen Kirchenprovinz Westfalen zählt er als Landpfarrer, Superintendent und Mitglied der Provinzial- und Generalsynode zu den prägenden Kirchenmännern des 19. Jahrhunderts. Huchzermeyer bleibt seit seinem Mandat in der Preußischen Nationalversammlung von 1848/49 der Christlich-Konservativen Partei und seiner monarchis-tischen Haltung treu. Als Pastor vertritt er dagegen die Positionen eines orthodoxen Lutheraners. Das Buch liefert weniger eine Biographie als vielmehr eine Wirkungsgeschichte über seine nachhaltigen Leistungen bezüglich der Inneren Mission.
109. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg, 2024

Uwe Standera
Zum Gedenken an Eberhard Delius
S. 4 - 8
Ulrich Andermann
Die Wahrnehmung Ravensbergs in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung
S. 9 - 22
Anna Krabbe
Zwischen Santiago und dem Luttenberg - Das Pilgerwesen in Herford
S. 23 - 39
Dieter Besserer
Die Kupferverarbeitung in Bielefeld seit dem 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Industriegeschichte
S. 40 - 72
Wolfgang Schindler
Die demografische Entwicklung Bielefelds in der Vormoderne und die konfessionelle Struktur der Bevölkerung
S. 73 - 126
Uwe Standera
Vom Franziskanermönch zum lutherischen Pfarrer.
Wilhelm Mey und seine Amtseinführung in Werther 1674
S. 127 - 152
Sebastian Schröder
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr! Das frühneuzeitliche Landschulwesen am Beispiel der Bauerschaft Getmold bei Preußisch Oldendorf
S. 153 - 195
Benjamin Magofsky
Eine Revolution in der Schulbibliothek? Vergleichende Sammlungsgeschichte zur Revolution von 1848 in den Bibliotheken des Ratsgymnasiums Bielefeld
S. 196 - 246
Vereinsbericht über das Jahr 2023
S. 247 - 252
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
S. 253
ISSN: 0342-0159
32. Sonderveröffentlichung
Von Zungen und Saiten –
Vier Generationen Harmonium- und Klavierbau Beyer in Wiehe, Bielefeld und Brackwede
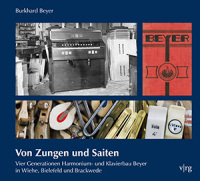
Autor: Burkard Beyer
1. Auflage, Umfang 248 Seiten, umfangreich bebildert, Querformat 24,0 x 21,5 cm
Einband gebunden
Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 2024, 29,90 €
ISBN 978-3-7395-1547-2
Im Sommer 1920 gründete der Harmoniumbauer Louis Moritz Beyer (1881–1945) in der thüringischen Kleinstadt Wiehe einen eigenen Betrieb. Schon bald beteiligten sich zwei Söhne an der Instrumentenherstellung in der kleinen Hinterhofwerkstatt. 1928 nahm die Familie das Angebot zur Mitarbeit bei einem Orgelbauer in Vlotho an, nach dem Scheitern der Verbindung entschied sie sich für den Umzug nach Bielefeld, wo sie auf Aufträge insbesondere aus Bethel hoffte. 1933 zog die Werkstatt nach Brackwede um. Nach dem Krieg betrieben Moritz und Otto Beyer den Harmoniumbau weiter, immer auf der Suche nach neuen technischen Lösungen. Nach einem Werkstattbrand 1959 trennten sich die Brüder, in den 1960er-Jahren kam die Nachfrage nach Harmonien zum Erliegen. 1977 übernahm Erhard Beyer den Betrieb und stellte auf Klavierbau um, seit 2018 betreibt Sebastian Beyer das Unternehmen in vierter Generation.
Das vorliegende, reich bebilderte Buch ist weit mehr als nur eine Familiengeschichte. Es ist zugleich ein Beitrag zur Technik- und Musikgeschichte, der an die Vielfalt eines fast schon vergessenen Instrumentes erinnert. Dargestellt wird anhand der zahlreich erhaltenen Dokumente aber auch die Geschichte eines Handwerksunternehmens, das sich mehrfach neu erfinden musste, um unter sich wandelnden Rahmenbedingungen erfolgreich sein zu können.
Inhalt
Vorwort
S. 7
Vorbemerkungen
S. 9
1. Die Vorgeschichte: Karl Beyer aus Hainichen
S. 11 – 15
2. Louis Moritz Beyer lernt den Harmoniumbau und geht nach Wiehe
S. 16 – 20
3. Wiehe „in Thüringen“
S. 21 – 25
4. Die Gründung eines eigenen Unternehmens in Wiehe 1920
S. 26 – 39
5. Die gescheiterte Anstellung in Vlotho-Wehrendorf
S. 40 – 44
6. Eine neue Werkstatt in Bielefeld-Gadderbaum
S. 45 – 57
7. Eine neue Heimat in Brackwede
S. 58 – 88
8. Die Firma Beyer im Zweiten Weltkrieg
S. 89 – 104
9. Neuer Anfang und neue Herausforderungen – die Nachkriegszeit und die Fünfziger Jahre
S. 105 – 156
10. Werkstattbrand und Trennung der Brüder Beyer
S. 157 – 169
11. Die letzten Jahre der Harmoniumherstellung
S. 170 – 201
12. Klavierbau als neuer Schwerpunkt – das Unternehmen in der dritten Generation
S. 202 – 214
13. Die vierte Generation: Sebastian Beyer
S. 215 – 228
14. Das Harmonium im Museum
S. 229 – 234
Quellen
S. 235
Literatur
S. 236 - 237
Internet
S. 237
Bildnachweis
S. 238
Register der Orte
S. 239 – 243
Register der Personen und Firmen
S. 244 - 248
Über den Autor
Dr. Burkhard Beyer, geboren 1968 in Bielefeld, aufgewachsen in Lippstadt. Studium Deutsch und Geschichte in Bielefeld, anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Forschungsprojektes zur Geschichte der Firma Krupp, 2002 Dissertation zur Technik- und Sozialgeschichte der Essener Gussstahlfabrik. 2004 Lektor für Regionalgeschichte in Münster, seit 2012 Geschäftsführer der Historischen Kommission für Westfalen (LWL). Zahlreiche Veröffentlichungen zur Regional-, Technik- und Eisenbahngeschichte.
31. Sonderveröffentlichung
"Der Freiheit Wimpel weht am Mast"
Selbstzeugnisse eines westfälischen Juden zwischen Assimilation und Emigration

Autor Willy Katzenstein
Eingeleitet und kommentiert von Johannes Altenberend (Herausgeber)
Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 2024, 59,00 €
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 87
ISBN 978-3-7395-1523-6
Weitere Informationen
"Der Freiheit Wimpel weht am Mast" - diese Verszeile hat Willy Katzenstein (1874 - 1951) Ende Mai 1939 während der Überfahrt ins englische Exil geschrieben. "Freiheit" war im Leben des Bielefelder Rechtsanwalts, Lokalpolitikers und vielbeschäftigen Funktionärs jüdischer Organisationen ein zentraler Begriff. Das gilt sowohl für seine Einstellung zum Judentum als auch für seine liberaldemokratischen Positionen in sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Sein Verständnis von Freiheit hat er in mehreren Selbstzeugnissen zum Ausdruck gebracht. Die in der Emigration in London geschriebene Autobiographie wie auch sein Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg sind eindrucksvolle Texte zur jüdischen Geschichte Westfalens. Sie erlauben tiefe Einblicke in die Gedankenwelt eines assimilierten Juden, der über sich selbst und die Lage der jüdischen Bevölkerung reflektiert.
Als Repräsentang der westfälischen Synagogen-Gemeinden war Katzenstein 1933 an der Gründung der Reichsvertretung der deutschen Juden beteiligt. Seine engen Beziehungen zu jüdischen Organisationen in Berlin waren die Voraussetzung dafür, dass er Einrichtungen zur Selbsthilfe geschaffen und die Auswanderung vieler Jüdinnen und Juden ermöglicht hat. Im Kriegstagebuch berichtet er detailliert über seinen Dienst von September 1914 bis November 1918 an verschiedenen Orten im besetzten Belgien. Als national orientierter Jude rechtfertigt er die deutsche Kriegspolitik und das Besatzungsregime. In dieser Zeit blendet er seine Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensge- meinschaft nahezu völlig aus.
Der Bearbeiter: Dr. Johannes Altenberend (geb. 1952 in Nieheim) unterrichtete Geschichte, Sozialwissenschaften und Religion an Bielefelder Gymnasien. Von 2004 bis 2019 war er Vorsitzender des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg . Zahlreiche Veröffentlichungen zur regionalen Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte.
Inhalt
Vorwort des Herausgebers S. 9
Preface of the Editor S. 11
Preface of Susan Hamlyn S.13
Vorwort von Susan Hamlyn S.15
I. Einleitung
1. Abriss der Lebensgeschichte von Willy Katzenstein (1874–1951) S. 17
2. Die Selbstzeugnisse Katzensteins – Überlieferung und Inhalt S. 30
a) Die Autobiographie S. 32
b) Die Artikel in jüdischen Zeitungen S. 34
c) Das Kriegstagebuch 1914–1918 S. 35
d) Die Feldpostkarten S. 39
3. Selbstzeugnisse als historische Quelle S. 40
4. Hinweise zur Edition S. 45
II. Autobiographie
Einleitung S. 49
Die Vorfahren S. 50
Kinderzeit S. 67
Schulzeit S. 72
Studentenzeit S. 85
Berlin S. 100
Einjährigenzeit S. 104
Referendarzeit S. 110
Als Referendar in Bielefeld S. 117
Rechtsanwalt in Bielefeld S. 132
Reisen S. 146
Wieder im bürgerlichen Leben S. 151
Im Ehestande
I. [Hochzeit] S. 163
II. [Inflation] S. 166
III. [Bekenntnis zur Republik] S. 168
IV. [Einsatz für die jüdische Gemeinschaft] S. 169
V. [Geburt und Tod] S. 172
Erfahrungen und Enttäuschungen S. 174
Ein Fehlurteil S. 185
Die Katastrophe – Zwischenbetrachtung und Bekenntnis S. 193
1933
I. [Hoffnungen und Enttäuschungen] S. 197
II. [Demütigungen im Alltag und die Gründung der Reichsvertretung der deutschen Juden] S. 199
1934, 1935, 1936, 1937 S. 213
1938 S. 231
November-Pogrom S. 240
Auswanderung S. 248
Gedichte 1939 S. 271
Abbildungsteil S. 273
III. Artikel in jüdischen Zeitungen
Ist die liberale Vereinigung auf dem richtigen Wege? [1909] S. 289
Taufjudentum und Antisemitismus [1914] S. 296
Zur Frage der Westjuden [1919] S. 300
Zur Frage der Gesamtorganisation [1920] S. 306
Ein liberaler deutscher Jude zu den jüdischen Problemen [1922] S. 312
Für die Jewish Agency [1929] S. 320
Judentum und jüdische Gemeinde [1931] S. 324
Brief an die Redaktion der Jüdischen Rundschau [Juni 1933] S. 329
Brief an die Redaktion der Jüdischen Rundschau [Juli 1933] S. 331
Ghetto, Emanzipation und jüdische Gegenwart [1934] S . 332
Ein Wort zum inneren Neubau [1935] S. 337
Sind jüdische Gruppensiedlungen möglich? [1938] S. 341
IV. Kriegstagebuch
Landsturm im Weltkrieg. Ein Kriegstagebuch 1914–1918
1914 S. 345
1915 S. 399
1916 S. 449
1917 S. 493
1918 S . 531
V. Feldpostkarten S. 609
VI. Anhang
Abkürzungsverzeichnis S. 635
Quellenverzeichnis S. 637
Veröffentlichungen von Willy Katzenstein S. 640
Literaturverzeichnis – Literatur bis 1945 S. 641
Literaturverzeichnis – Literatur nach 1945 S. 644
Personenregister S. 665
Ortsregister S. 673
30. Sonderveröffentlichung
Recht, Richter und Gerichte in Ravensberg
Rechtsgeschichte einer Grafschaft
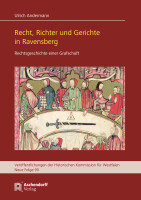
Ulrich Andermann
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Bandnummer 90
Aschendorff Verlag, Münster 2024, Bestell-Nr. 15152, ISBN 978-3-402-15152-5, 39,00 €
Weitere Informationen
Mit der vorliegenden Rechtsgeschichte der Grafschaft Ravensberg wird ein Zeitraum von rund 1000 Jahren - von den ersten Vogteigerichten noch vor Entstehung der Grafschaft bis zum Ende der Franzosenzeit 1813 - systematisch untersucht. Dabei werden das Stift und die Stadt Herford von Beginn an in die Untersuchung mit einbezogen. Da sowohl im Mittelalter als auch in der Frühen Neuzeit Justiz und Verwaltung eng miteinander verflochten waren, bietet die Darstellung - über Recht und Verfassung hinaus - auch einen wichtigen Einblick in die Verwaltungsgeschichte und in die Ämterverfassung der Grafschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ursprünge und Zuständigkeiten der jeweiligen Gerichte sowie ihr Personal. Hinsichtlich der Prozessform erwies sich die Rezeption des römischen Rechts als Zäsur, ebenso wie später das Eindringen des französischen Rechts nach dem Ende des Alten Reiches. Stets gegenübergestellt werden die ländliche und städtische Rechtswelt, neben der weltlichen wird immer auch die geistliche Gerichtsbarkeit mit in den Blick genommen. Einige Sachverhalte, wie etwa die Holzgerichtsbarkeit oder die Hexenprozesse, werden für Ravensberg erstmals untersucht, während zu anderen Themen bislang geltende Sichtweisen revidiert werden. Das gilt auch für die Frage, inwieweit das seit 1346 als „Nebenland" geltende Ravensberg in den verschiedenen „Mehrfachherrschaften" seine eigene Entwicklung bewahren konnte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort • 9Einleitung
I. Rechtsgeschichte einer Grafschaft?
Gegenstand und Aufbau der Untersuchung • 11
II. Forschungen zu Ravensberg • 15
III. Voraussetzungen und Ausgangslage • 20
A. Die ländliche Rechtswelt im Mittelalter • 25
I. Weltliche Gerichte: Herkunft, Zuständigkeit und Entwicklung • 26
1. Vogteigerichte • 26
2. Freigerichte • 29
3. Femegerichtsbarkeit • 38
4. Gogerichte • 42
5. Amtsstubengerichte • 51
II. Gräfliche Gerichtshoheit? • 57
III. Geistliche Gerichtsbarkeit • 60
B. Das Rechts- und Gerichtswesen
im mittelalterlichen Herford und Bielefeld • 67
I. Strukturen und Ordnungen • 68
1. Stadtverfassung • 68
2. Stadtrechte und Bürgersprachen • 72
II. Städtische Gerichtsbarkeit: Standorte, Zuständigkeit und Personal
1. Die Stiftsstadt Herford • 78
a. Das Vogtgericht • 78
b. Das Burggericht der Alt- und Neustadt • 86
c. Das Burgericht der Neustadt • 87
2. Das Stadt- bzw. Ratsgericht der Bielefelder Alt- und Neustadt • 90
3. Sanktionen und ihre Überlieferung • 97
4. Geistliche Gerichtsbarkeit • 98
5. Appellationswesen und Rechtsweisungen • 102
6. Das Verhältnis zu der Reichsgerichtsbarkeit • 105
C. Ravensberg als Teil des Reiches und als herzogliches Nebenland bis 1609 • 107
I. Einflüsse des Reiches • 107
1. Reichskammergericht und Reichshofrat • 108
2. Die Folgen der Constitutio Criminalis Carolina von 1532 • 111
3. Bedeutung der Reichspolizeiordnungen • 113
II. Die Grafschaft als Nebenland der Herzöge von Jülich-Kleve-Berg
1. Herfords Verhältnis zu Ravensberg • 116
2. Das Problem der landständischen Verfassung • 119
3. Die Gerichtsverfassung zu Zeiten der Landesvisitation 1535 • 123
4. Die ravensbergische Gerichtsreform (1556)
a. Einordnung und Vorbereitung • 127
b. Die neue Gerichtsverfassung • 130
c. Wandlungen durch die Rezeption des römischen Rechts • 132
aa.Verfahrensrecht • 133
bb. Gerichtspersonal • 134
cc. Beweisrecht • 134
dd. Appellationswesen • 135
5. ,,Gute Policey":
Landesherrliche und kommunale Ordnungen • 136
6. Geistliche Gerichtsbarkeit im Reformationsjahrhundert • 140
D. Die Grafschaft unter brandenburgischer
und pfalz-neuburgischer Herrschaft ab 1609 • 143
I. Die Integration des Nebenlandes Ravensberg
1. Adelsland und konsensualer Zentralismus • 145
2. Ravensbergisches lndigenatsrecht • 147
II. Die Gerichtsverfassung • 151
1. Auf dem Land • 152
a. Brüchten- und Amtsstubengerichte • 153
b. Vögte und Untervögte • 155
c. Gogerichtsbarkeit • 157
d. Das Amt des Landschreibers • 160
e. Das Phänomen der Holzgerichtsbarkeit • 163
2. Gerichtsverhältnisse in den Städten • 168
a. Herford • 168
b. Bielefeld • 175
III. Landesherrliche Instanzen und Ordnungen
a. Ravensbergische Kanzlei (1647-1653),
Amtskammer und Kommissariat • 182
b. Das Ravensbergische Appellationsgericht
(1653-1750) • 189
c. Policey- und Brüchtenordnungen • 193
III. Die geistliche Gerichtsbarkeit • 197
IV. Hexenverfolgungen in Ravensberg? • 203
E. Das königlich-preußische Ravensberg bis 1806
I. Politische Neugestaltungen seit 1719 • 213
1. Die Vereinigung von Minden und Ravensberg • 213
2. Gründung der „Akzisestädte" • 216
3. Das Ende der Gogerichtsbarkeit • 221
4. Kriegs- und Domänenkammer • 223
5. Ämterverfassung nach 1722/23 • 226
II. Recht und Ordnung auf dem Land und in den Städten
1. Justizpflege auf dem Ravensberger Land • 230
2. Die städtische Justiz • 232
a. Herford
aa. Reformen des „Rathäuslichen Reglements" (1721) • 232
bb. Das Policey-Wesen • 236
Die geistliche Gerichtsbarkeit • 238
b. Bielefeld
aa. Die Rats- und Verwaltungsreform 1719 • 239
bb. Das Brüchtenwesen • 241
cc. Die geistliche Gerichtsbarkeit • 243
3. Die Jurisdiktion der Regierung in Minden:
Anspruch und Wirklichkeit • 244
4. Kriminalgerichtsbarkeit und Hinrichtungen in Ravensberg • 249
5. Königliche Verordnungstätigkeit auf dem Land • 260
III. Ravensberg und das preußische Justizwesen • 268
1. Institutionen
a. Das Oberappellationsgericht (1703-1748) • 269
b. Vereinigung von Ravensbergischem Appellations- und Kammergericht (1750) • 274
c. Das Verhältnis zu den Reichsgerichten • 278
2. Ravensbergisches Justizwesen auf dem Prüfstand
a. Ravensbergische Rechtsfälle in der Konsilienliteratur. • 281
b. Das Gerichtswesen im Spiegel von Beschwerdeschriften und Justizvisitationen • 287
c. Ausbildungsprofil der Amtsträger • 292
3. Rechtsreformen bis zum Ende des Alten Reiches
a. Der lange Weg zum Allgemeinen Landrecht • 300
b. Zur normativen Entwicklung der Kriminalgerichtsbarkeit • 306
F. Ravensberg im Königreich Westphalen und Kaiserreich Frankreich • 319
I. Verwaltungsgliederung und Ämterbesetzung • 321
II. Zur Modernität des französischen Rechts
1. Die Bedeutung des „Code Civil" • 327
2. Gerichtsverfassung und Prozessrecht: Norm und Wirklichkeit • 330
III. Die Rezeption und die Frage: Was blieb? • 335
Schlussbetrachtung und Ausblick • 339
Anhang
Abkürzungen • 349
Verzeichnis der zitierten Archivalien • 351
Gedruckte Quellen • 353
Literatur • 359
Personenregister • 385
Ortsregister • 393