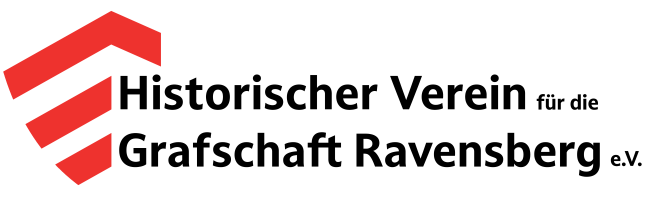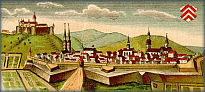Neuerscheinungen
30. Sonderveröffentlichung
Recht, Richter und Gerichte in Ravensberg
Rechtsgeschichte einer Grafschaft
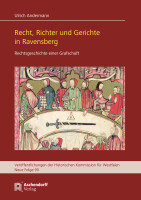
Ulrich Andermann
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Bandnummer 90
Aschendorff Verlag, Münster 2024, Bestell-Nr. 15152, ISBN 978-3-402-15152-5, 39,00 €
Weitere Informationen
Mit der vorliegenden Rechtsgeschichte der Grafschaft Ravensberg wird ein Zeitraum von rund 1000 Jahren - von den ersten Vogteigerichten noch vor Entstehung der Grafschaft bis zum Ende der Franzosenzeit 1813 - systematisch untersucht. Dabei werden das Stift und die Stadt Herford von Beginn an in die Untersuchung mit einbezogen. Da sowohl im Mittelalter als auch in der Frühen Neuzeit Justiz und Verwaltung eng miteinander verflochten waren, bietet die Darstellung - über Recht und Verfassung hinaus - auch einen wichtigen Einblick in die Verwaltungsgeschichte und in die Ämterverfassung der Grafschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ursprünge und Zuständigkeiten der jeweiligen Gerichte sowie ihr Personal. Hinsichtlich der Prozessform erwies sich die Rezeption des römischen Rechts als Zäsur, ebenso wie später das Eindringen des französischen Rechts nach dem Ende des Alten Reiches. Stets gegenübergestellt werden die ländliche und städtische Rechtswelt, neben der weltlichen wird immer auch die geistliche Gerichtsbarkeit mit in den Blick genommen. Einige Sachverhalte, wie etwa die Holzgerichtsbarkeit oder die Hexenprozesse, werden für Ravensberg erstmals untersucht, während zu anderen Themen bislang geltende Sichtweisen revidiert werden. Das gilt auch für die Frage, inwieweit das seit 1346 als „Nebenland" geltende Ravensberg in den verschiedenen „Mehrfachherrschaften" seine eigene Entwicklung bewahren konnte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort • 9Einleitung
I. Rechtsgeschichte einer Grafschaft?
Gegenstand und Aufbau der Untersuchung • 11
II. Forschungen zu Ravensberg • 15
III. Voraussetzungen und Ausgangslage • 20
A. Die ländliche Rechtswelt im Mittelalter • 25
I. Weltliche Gerichte: Herkunft, Zuständigkeit und Entwicklung • 26
1. Vogteigerichte • 26
2. Freigerichte • 29
3. Femegerichtsbarkeit • 38
4. Gogerichte • 42
5. Amtsstubengerichte • 51
II. Gräfliche Gerichtshoheit? • 57
III. Geistliche Gerichtsbarkeit • 60
B. Das Rechts- und Gerichtswesen
im mittelalterlichen Herford und Bielefeld • 67
I. Strukturen und Ordnungen • 68
1. Stadtverfassung • 68
2. Stadtrechte und Bürgersprachen • 72
II. Städtische Gerichtsbarkeit: Standorte, Zuständigkeit und Personal
1. Die Stiftsstadt Herford • 78
a. Das Vogtgericht • 78
b. Das Burggericht der Alt- und Neustadt • 86
c. Das Burgericht der Neustadt • 87
2. Das Stadt- bzw. Ratsgericht der Bielefelder Alt- und Neustadt • 90
3. Sanktionen und ihre Überlieferung • 97
4. Geistliche Gerichtsbarkeit • 98
5. Appellationswesen und Rechtsweisungen • 102
6. Das Verhältnis zu der Reichsgerichtsbarkeit • 105
C. Ravensberg als Teil des Reiches und als herzogliches Nebenland bis 1609 • 107
I. Einflüsse des Reiches • 107
1. Reichskammergericht und Reichshofrat • 108
2. Die Folgen der Constitutio Criminalis Carolina von 1532 • 111
3. Bedeutung der Reichspolizeiordnungen • 113
II. Die Grafschaft als Nebenland der Herzöge von Jülich-Kleve-Berg
1. Herfords Verhältnis zu Ravensberg • 116
2. Das Problem der landständischen Verfassung • 119
3. Die Gerichtsverfassung zu Zeiten der Landesvisitation 1535 • 123
4. Die ravensbergische Gerichtsreform (1556)
a. Einordnung und Vorbereitung • 127
b. Die neue Gerichtsverfassung • 130
c. Wandlungen durch die Rezeption des römischen Rechts • 132
aa.Verfahrensrecht • 133
bb. Gerichtspersonal • 134
cc. Beweisrecht • 134
dd. Appellationswesen • 135
5. ,,Gute Policey":
Landesherrliche und kommunale Ordnungen • 136
6. Geistliche Gerichtsbarkeit im Reformationsjahrhundert • 140
D. Die Grafschaft unter brandenburgischer
und pfalz-neuburgischer Herrschaft ab 1609 • 143
I. Die Integration des Nebenlandes Ravensberg
1. Adelsland und konsensualer Zentralismus • 145
2. Ravensbergisches lndigenatsrecht • 147
II. Die Gerichtsverfassung • 151
1. Auf dem Land • 152
a. Brüchten- und Amtsstubengerichte • 153
b. Vögte und Untervögte • 155
c. Gogerichtsbarkeit • 157
d. Das Amt des Landschreibers • 160
e. Das Phänomen der Holzgerichtsbarkeit • 163
2. Gerichtsverhältnisse in den Städten • 168
a. Herford • 168
b. Bielefeld • 175
III. Landesherrliche Instanzen und Ordnungen
a. Ravensbergische Kanzlei (1647-1653),
Amtskammer und Kommissariat • 182
b. Das Ravensbergische Appellationsgericht
(1653-1750) • 189
c. Policey- und Brüchtenordnungen • 193
III. Die geistliche Gerichtsbarkeit • 197
IV. Hexenverfolgungen in Ravensberg? • 203
E. Das königlich-preußische Ravensberg bis 1806
I. Politische Neugestaltungen seit 1719 • 213
1. Die Vereinigung von Minden und Ravensberg • 213
2. Gründung der „Akzisestädte" • 216
3. Das Ende der Gogerichtsbarkeit • 221
4. Kriegs- und Domänenkammer • 223
5. Ämterverfassung nach 1722/23 • 226
II. Recht und Ordnung auf dem Land und in den Städten
1. Justizpflege auf dem Ravensberger Land • 230
2. Die städtische Justiz • 232
a. Herford
aa. Reformen des „Rathäuslichen Reglements" (1721) • 232
bb. Das Policey-Wesen • 236
Die geistliche Gerichtsbarkeit • 238
b. Bielefeld
aa. Die Rats- und Verwaltungsreform 1719 • 239
bb. Das Brüchtenwesen • 241
cc. Die geistliche Gerichtsbarkeit • 243
3. Die Jurisdiktion der Regierung in Minden:
Anspruch und Wirklichkeit • 244
4. Kriminalgerichtsbarkeit und Hinrichtungen in Ravensberg • 249
5. Königliche Verordnungstätigkeit auf dem Land • 260
III. Ravensberg und das preußische Justizwesen • 268
1. Institutionen
a. Das Oberappellationsgericht (1703-1748) • 269
b. Vereinigung von Ravensbergischem Appellations- und Kammergericht (1750) • 274
c. Das Verhältnis zu den Reichsgerichten • 278
2. Ravensbergisches Justizwesen auf dem Prüfstand
a. Ravensbergische Rechtsfälle in der Konsilienliteratur. • 281
b. Das Gerichtswesen im Spiegel von Beschwerdeschriften und Justizvisitationen • 287
c. Ausbildungsprofil der Amtsträger • 292
3. Rechtsreformen bis zum Ende des Alten Reiches
a. Der lange Weg zum Allgemeinen Landrecht • 300
b. Zur normativen Entwicklung der Kriminalgerichtsbarkeit • 306
F. Ravensberg im Königreich Westphalen und Kaiserreich Frankreich • 319
I. Verwaltungsgliederung und Ämterbesetzung • 321
II. Zur Modernität des französischen Rechts
1. Die Bedeutung des „Code Civil" • 327
2. Gerichtsverfassung und Prozessrecht: Norm und Wirklichkeit • 330
III. Die Rezeption und die Frage: Was blieb? • 335
Schlussbetrachtung und Ausblick • 339
Anhang
Abkürzungen • 349
Verzeichnis der zitierten Archivalien • 351
Gedruckte Quellen • 353
Literatur • 359
Personenregister • 385
Ortsregister • 393
28. Sonderveröffentlichung
Die Grafschaft Ravensberg im 17. Jahrhundert
Verfassung – Recht – Wirtschaft – Kultur
Beiträge des zweiten Ravensberger Kolloquiums

Herausgegeben von Ulrich Andermann und Michael Zozmann
Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 2023
S. 299, 29,00 €
Vorwort
S. 7 – 9
Wolfgang Schindler
Landesherrschaft in der Grafschaft Ravensberg in wechselhaften Zeiten (1609–1653)
S. 11 – 49
Tobias Schenk
Das Ravensbergische Appellationsgericht zu Cölln an der Spree (1653–1750).
Ein frühneuzeitliches Justizkollegium im Spannungsfeld von Reichs- und Territorialgerichtsbarkeit
S. 51 – 130
Nicolas Rügge
Ravensberger Juristen im 17. Jahrhundert.
Funktionen – Karrieren – territoriale Verflechtung
S. 131 – 150
Uwe Standera
Die Landhauptmänner der Grafschaft Ravensberg.
Aspekte eines militärischen Amtes des 17. und 18. Jahrhunderts
S. 151 – 172
Philipp Koch
Kriege, Krisen, Konjunkturen.
Bevölkerung und wirtschaftliche Wechsellagen in der Grafschaft Ravensberg im langen 17. Jahrhundert (1609/1647/1666-1719/1723)
S. 173 – 203
Sebastian Schröder
Gemeindealltag und Glaubenspraxis.
Strukturen und Akteure ravensbergischer Landkirchspiele in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
S. 205 – 238
Ulrich Andermann
Cuius regio, eius religio?
Ravensbergische Stiftskonvente und die Bekenntnisfrage im 17. Jahrhundert
S. 239 – 260
Lutz Volmer
Ländlicher Hausbau und Sachkultur zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und in der anschließenden Konsolidierungsphase (1620–1720)
S. 261 – 285
Abkürzungen
S. 286
Personenregister
S. 287 – 292
Ortsregister
S. 293 – 296
Die Autoren
S. 297 - 299
ISSN 1619-9022
ISBN 978-3-7395-1520-5
108. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg, 2023

Benjamin Magofsky/Johanna Meyer
Einmalig – ein mittelniederdeutscher Marienpsalter aus der historischen Bibliothek des Ratsgymnasiums Bielefeld
S. 7 – 33
Wolfgang Schindler
Gografen, Schöffen und Gerichtsschreiber der ravensbergischen Gogerichte (1558 – 1719)
S. 35 – 129
Lasse Stodollick
Das Gesetz des Wiedersehens. Anwesenheit und Kollegialität in der Mindener Kriegs- und Domänenkammer (1723 – 1806)
S. 131 – 148
Jürgen Büschenfeld
Von Herren- und Untermenschen. Zum Umgang mit Kriegsgefangenen, Zwangs- und Fremdarbeitern in Steinhagen
S. 149 – 169
Petra Wissbrock
Major Douglas MacOlive, Stadtkommandant von Bielefeld 1945 – 1951
S. 171 – 199
Falk Pingel
Eine lange Geschichte von Erinnern und Gedenken – zum geplanten Ausbau der Gedenkstätte Stalag 326 in Stukenbrock/Senne
S. 201 – 231
Vereinsbericht über das Jahr 2022
S. 233 – 238
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
S. 239
ISSN: 0342-0159
Ravensberger Blätter, Ausgabe 2023
Schule und Bildung
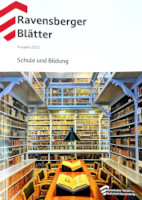
-
Beiträge
Das Problem mit den mittelalterlichen Stiftsschulen und -bibliotheken
Ulrich Andermann
S. 4 - 11Humanistische Spuren in Ravensberg
Ulrich Andermann
S. 12 - 19Die historische Bibliothek im Ratsgymnasium Bielefeld. Ein verborgenes Kulturerbe
Benjamin Magofsky
S. 20 - 29Die Schildescher Präparande als Baustein kirchlicher Jugendarbeit
Ulrich Rottschäfer
S. 30 - 37„Zur Veredlung der Jugend“. Die schülerfreundliche Pädagogik des Christian Kern im französischen Versmold von 1810
Rolf Westheider
S. 38 - 45Die Dörpfeldschule in Bielefeld (1947 - 1968)
Dieter Nolden
S. 46 - 57Das Bielefelder Oberstufen-Kolleg als Reformprojekt
Wiebke Fiedler-Ebke und Helga Jung-Paarmann
S. 58 - 67Anwendungsorientierte Hochschulbildung in Bielefeld 1971 - 2023. Von der FH zur Hochschule Bielefeld - University of Applied Sciences and Arts
Andreas Beaugrand
S. 68 - 79 -
Vereinsnachrichten
Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins (4. März 2023)
Ulrich Andermann
S. 80Exkursion nach Herzebrock, Böddeken und Neuenheerse (24. Juni 2023)
Ulrich Andermann
S. 81Zwei neue Arbeitsgemeinschaften: „Mittelalter und Frühe Neuzeit“ und „Baukultur und Denkmalpflege“
Ulrich Andermann
S. 82Bericht zum Workshop „Gedenk- und Vermittlungsperspektiven einer zukünftigen internationalen Gedenk- und Dokumentationsstätte ,Stalag 326‘“
Martin Kolek
S. 83 - 86Trauer um Joachim Klenner
Jürgen Büschenfeld
S. 87Nachruf auf Bernd J. Wagner - Ein Leben für die Bielefelder Stadtgeschichte
Rolf Botzet, Jürgen Büschenfeld und Bärbel Sunderbrink
S. 88 - 89 -
Buchanzeigen
Hans-Peter Boer, Entstehung und Gründung der Dorf- und Landschulen im Oberstift Münster 1571 bis 1803 (Ulrich Andermann)
S. 90Hiltrud Böcker-Lönnendonker, Else Zimmermann (1907 - 1995). Widerstandskämpferin und erste Landrätin der Bundesrepublik (Bärbel Sunderbrink)
S. 90 - 91Werner Freitag, Westfalen. Geschichte eines Landes, seiner Städte und Regionen in Mittelalter und Früher Neuzeit (Peter Riedel)
S. 91Ulrich Rottschäfer, Lieddichtung der Gohfelder Erweckung - Minden-Ravensberger Glaubenslyrik im 18. Jahrhundert. Vier Dichter, ihre Biografien und Werke, ihr Fortleben im heutigen Pietismus (Wolfgang Günther)
S. 92Neuerwerbungen der Landesgeschichtlichen Bibliothek Bielefeld
S. 93 - 94 -
Veranstaltungshinweise
Verleihung des Gustav-Engel-Preises (25. November 2023) (Ulrich Andermann)
S. 953. Tag der Regionalgeschichte (2. März 2024) (Peter Riedel)
S. 95Impressum / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Heftes
S. 96
27. Sonderveröffentlichung
„Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät allerunterthänigster Diener“
Briefe Georg Ernst Hinzpeters an Kaiser Wilhelm II. aus den Jahren 1897 - 1906

Edition und Kommentar von Gerhard Schneider
Inhalt
Vorwort
S. 7 – 12
Einleitung
Die Überlieferung
S. 13 – 22
Die Form
S. 23 – 26
Der Inhalt
S. 26 – 36
Der Briefeschreiber Georg Hinzpeter und seine Stellung in der Gesellschaft seiner Zeit
S. 37 – 51
Verzeichnis der Briefe
S. 53 – 55
Die Edition
S. 56 – 212
Anhang
Öffentlicher Widerspruch Hinzpeters gegen einen Bericht in den „Hamburger Nachrichten“
S. 213 – 214
Telegramm des Kaisers an Hinzpeter vom 28. Februar 1896, erschienen in der Tageszeitung „Die Post“ vom 15. Mai 1896
S. 215
Charakterisierung Hinzpeters durch Poultney Bigelow
S. 216 - 217
Einige weitere Briefe Hinzpeters an Kaiser Wilhelm II.
S. 218 – 226
Äußerungen Hinzpeters über „Kaiserin Friedrich“ am 20. Oktober 1903
S. 227 – 228
Abbildungen
S. 229 – 232
Bibliographie
Archivalien
S. 233
Gedruckte Quellen
S. 233 – 236
Tageszeitungen
S. 236
Literatur
S. 236 - 239
Titelbilder:
Kaiser Wilhelm II., Ansichtskarte und Georg Ernst Hinzpeters, StA Bielefeld
27. Sonderveröffentlichung des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg e. V.
Verlag für Regionalgeschichte, 2023
ISSN 1619-9022
ISBN 978-3-7395-1508-3
239 Seiten
29,00 €
Nachdem der preußische Prinz Wilhelm 1877 am Kasseler Gymnasium das Abitur abgelegt hatte, endete Georg Ernst Hinzpeters Dienst als sein Erzieher. Den Kontakt zu seinem ehemaligen „Zögling“ hielt Hinzpeter auch nach seinem Rückzug nach Bielefeld bis zu seinem Tode Ende 1907 aufrecht. Von seinen vielen Briefen an den Prinzen und späteren Kaiser ist nur der hier edierte Bruchteil erhalten geblieben. Randbemerkungen, Unterstreichungen und Verweise von der Hand Wilhelms II. dokumentieren, dass der Kaiser die Briefe seines ehemaligen Erziehers mindestens zur Kenntnis genommen hat.
Welch bedeutende Persönlichkeit Hinzpeter bis zu seinem Lebensende war, hat man in Bielefeld nur dann wahrgenommen, wenn der Kaiser zu Besuch in der Stadt weilte und dabei stets bei seinem alten Lehrer einkehrte. Ansonsten lebte Hinzpeter sehr zurückgezogen. Zu den führenden Personen der Stadt hatte er – mit Ausnahme zu Friedrich von Bodelschwingh – kaum Kontakt. Seine große Bühne war vor allem in der Zeit des Sturzes Otto von Bismarck die Hauptstadt Berlin, wo er in den höchsten Kreisen verkehrte und von allen großen Persönlichkeiten wegen seiner fortdauernden Nähe zum Kaiser kontaktiert wurde. Dieser einst so einflussreiche Mann ist in Bielefeld heute weitgehend vergessen.